Our blog articles are only available in German, French or Italian.
By default, the content on this page is therefore displayed in German.
Veränderungen stören unser Funktionieren

Claudia Beutter, warum tun wir Menschen uns schwer mit Veränderungen?
Veränderungen stören unser eingeübtes Funktionieren. Wir machen sehr vieles automatisch, brauchen dafür keine besondere Energie und können uns darauf verlassen, dass wir sofort aufmerksam werden, wenn etwas anders ist. Das gilt sowohl für die alltäglichen Abläufe vom Aufstehen bis zum Eintreffen bei der Arbeit als auch für unsere Arbeitsroutinen. Ohne diese Automatismen wären Leben und Arbeiten gar nicht möglich.
Die Schweizer Justiz und mit ihr das Bundesverwaltungsgericht befindet sich aktuell in einem tiefgreifenden Digitalisierungsprozess. Wie sieht da gutes Veränderungsmanagement aus?
Von aussen kann ich das nicht so einfach sagen, dafür müsste ich gezielte Fragen nach dem Was, Wer, Wie und Wann stellen. Generell ist es aber wichtig, dass die von Veränderung Betroffenen früh involviert werden und deren Expertise nicht erst in der Umsetzung genutzt wird. Die Führung kann zudem unterstützen, indem sie akzeptiert, dass in Veränderungen Abläufe, Qualität, Geschwindigkeit erst einmal schlechter werden, bevor sie besser werden. Zudem gilt: Je stärker das berufliche Selbstverständnis durch die Veränderung tangiert ist, desto anspruchsvoller wird es für die Betroffenen, sich zu ändern.
Sie beraten neben Ihrer Arbeit als Dozentin an der ZHAW Unternehmen in Veränderungen. Worum geht es da?
Gründe für eine Organisationsberatung können bereits gestartete Vorhaben sein, die ins Stocken geraten sind, oder interne Change-Verantwortliche, die sich eine externe Sparringpartnerin wünschen. Eine Aussenperspektive ist oft hilfreich, um sich unbewusste Muster und Abläufe bewusst zu machen und Normalitäten zu hinterfragen, die sich in Bezug auf die geplante Veränderung als Hindernis oder als erhaltenswerte Kultur erweisen können. Auch Information und Kommunikation sind zentral – vom Zeitpunkt über Form und Häufigkeit bis hin zum Austausch und mitgestaltenden Einbezug. Ganz grundsätzlich gilt es herauszufinden, was der Übergang vom «Ist» zum «Soll» für die betroffenen Personen bedeutet und wie sie dabei unterstützt werden können.
Warum scheitern Veränderungsprozesse, und wie kann das vermieden werden?
Zuerst gilt es zu klären, was mit Scheitern gemeint ist. Sind es nicht erreichte Ziele oder Absichten, abgebrochene Projekte oder das Abspringen von zu vielen Mitarbeitenden? Aus meiner Erfahrung können etwa sich widersprechende Veränderungsziele zu einem Scheitern führen. Um das zu vermeiden, braucht es ein Verständnis dafür, warum es in der Organisation so läuft, wie es gerade läuft, warum Führungskräfte und Mitarbeitende so agieren, wie sie es tun. Denn das hat immer auch gute Gründe, ist wahrscheinlich das Resultat vorheriger Veränderungen. Wer den Schritt auslässt, dies zu verstehen, riskiert, dass wichtige erwünschte Prozesse, Verhaltensweisen und Zusammenarbeitsformen mit einer Veränderung verschwinden.
«Wenn Mitarbeitende Veränderungen nicht skeptisch oder ablehnend gegenüberstehen, ist es wichtig, zwei Hypothesen zu prüfen: Zweifeln sie daran, dass die angekündigte Veränderung wirklich realisiert wird? Oder haben sie bereits aufgegeben und engagieren sich nur noch so weit, wie es absolut sein muss?»
Claudia Beutter
Zurück zur Digitalisierung: Verstehen Sie, wenn Mitarbeitende aufgrund des hohen Tempos der Veränderungen müde werden und Neuerungen skeptisch oder gar ablehnend gegenüberstehen?
Was digitale Veränderungen beruflich und privat mit uns machen, beginnen wir gerade erst zu erkennen. Die Pandemie hat gezeigt, was die Digitalisierung für die Arbeit und Zusammenarbeit bedeutet: Individualisierung und Vereinzelung. Reine Online-Begegnungen und nur noch speziell vereinbarte persönliche Treffen haben vielerorts das gegenseitige Verständnis beeinträchtigt und die Anzahl der Missverständnisse stark erhöht. Wenn Mitarbeitende den Veränderungen nicht skeptisch oder ablehnend gegenüberstehen, ist es wichtig, zwei Hypothesen zu prüfen: Zweifeln sie daran, dass die angekündigte Veränderung wirklich realisiert wird? Oder haben sie bereits aufgegeben und engagieren sich nur noch so weit, wie es absolut sein muss? Möglicherweise hat ihr Weggang aus der Organisation innerlich bereits begonnen.
Was raten Sie in einem solchen Fall?
Vorgesetzte unterstützen Veränderungen, indem sie bewusst entscheiden und die Betroffenen frühzeitig einbeziehen. So können diese ihre Expertise einbringen, sich innerlich mit den Neuerungen auseinandersetzen und das «Ist» früher loslassen. Sie wissen dann bei der Umsetzung, warum wie entschieden wurde und sind eher überzeugt, dass das Neue funktionieren wird. Wenn Vorgesetzte ihre Mitarbeitenden als kompetent und wichtig wahrnehmen, brauchen sie die Änderung auch nicht als Lösung zu verkaufen, denn damit machen sie die Betroffenen unbeabsichtigt zu Aber-Sagerinnen. Kompetente Vorgesetzte «verkaufen» das bestehende oder sich abzeichnende Problem. So fragen sie um Mithilfe, wertschätzen die Fähigkeiten der Mitarbeitenden und machen sie zum Teil der entstehenden Lösung.
Dann reicht es nicht, den Mitarbeitenden die neuen Tools zur Verfügung zu stellen und sie darin zu schulen?
Der Aufwand, den Veränderungen für das Hirn bedeuten – neue Vernetzungen anlegen, Altes «entlernen» und Neues verstehen und einüben – ist beträchtlich. Wer sich dabei nur auf die veränderten Tools verlässt, unterschätzt die Auswirkungen dieses Prozesses. Zudem sind diejenigen, die die Tools auswählen, oft nicht diejenigen, die sie dann anwenden. Sie kennen zwar die Vorteile, unterschätzen aber, wieviel es braucht, bis das neue Tool diese Vorteile bringt und genauso versiert bedient und genutzt werden kann wie das alte. Deshalb sollten Vorgesetzte eine ablehnende Reaktion auf eine Neuerung auch nicht auf sich selbst beziehen, denn sie ist eine natürliche menschliche Verteidigung der bestehenden und gut laufenden Automatismen.
Grosse Neuerungen bringen KI-basierte Anwendungen mit sich, die sich so rasend schnell entwickeln, dass viele um ihre Jobs bangen. Was raten Sie Betroffenen?
Solche Ängste verstehe ich sehr gut, denn technologische Entwicklungen können Berufe und damit Personal existenziell betreffen. Die Verarbeitung von bedrohlichen Entwicklungen beziehungsweise der Umgang mit Unsicherheit ist sehr individuell. Wichtig scheint mir, einen Umgang mit dem zu finden, was im Aussen nicht gesteuert oder direkt beeinflusst werden kann: Technologie, Arbeitsmarkt, andere Menschen usw. Es geht darum, die Sicht auf die Umwelt so zu verändern, damit man sich selbst wieder als wirkungsvoll erlebt. Hilfreich hierbei ist, offen mit anderen Menschen darüber zu reden, was einen ängstigt oder wo man sich gelähmt fühlt. Sie können einem sagen, welche Möglichkeiten, Stärken oder Potenziale sie sehen und welche Hindernisse oder Grenzen man sich selbst setzt.
Was tun Sie persönlich, wenn Sie Mühe mit Veränderungen haben?
Wenn mir Veränderungen in der eigenen Organisation Mühe bereiten, äussere ich das. Ich beobachte mich dabei und gehe dem nach, was mir Mühe, Angst, Sorgen und Unlust bereitet. Das hilft mir zu verstehen, was bei mir los ist. So kann ich mich für einen Änderungsprozess innerlich gut aufstellen. Das kann mit dem Akzeptieren beginnen, dass es schwierig, anders und neu überfordernd wird. Dann folgen Fragen nach Unterstützung bei Kolleginnen, Freunden, Familie. Schliesslich führt es bei mir zu einem Entscheid, wie ich mit der Veränderung umgehe, etwas Neues lerne, meine Aufmerksamkeit auf andere Dinge lenke oder mich grundsätzlich mit meiner Arbeitssituation auseinandersetze.
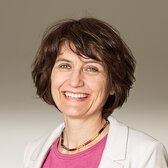
Claudia Beutter
Claudia Beutter, Organisationsberaterin und Dozentin am Institut für Angewandte Psychologie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, hat mehrjährige Führungserfahrung in strukturellen Veränderungsprozessen grösserer und mittlerer Organisationen. Sie berät und coacht Change-Verantwortliche und Geschäftsleitungsteams in Veränderungsprozessen. Diese können die Erneuerung einer Vision betreffen, das Zusammenführen von Unternehmen, den Verkauf eines Unternehmensteils, einen Kultur- oder Strategiewechsel, eine Umstrukturierung oder Reorganisation usw.
Weitere Blogeinträge
Mehr Zeit zum Denken und Urteilen
Künstliche Intelligenz wird die Arbeit in der Justiz markant verändern, sagt Peter Wildhaber. Der Leiter IT & Transformation über Chaos, digitale Justiz und Zugvögel.
Der Veränderungsprofi
Im Umgang mit beruflichen Veränderungen ist HR-Leiter Michaël Studer erprobt. Auch privat hat der ehemalige Basketballprofi, der in sieben Ländern aufgewachsen ist, schon viele Wechsel erlebt.
